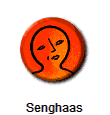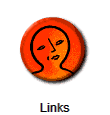|
|
Heide Anger / Peter Schulthess (Hrsg.): Gestalt-Traumatherapie – vom Überleben zum Leben. Köln (EHP) 2008 Die beiden HerausgeberInnen schreiben in ihrem ausführlichen Vorwort zu diesem Buch: „Mit diesem Buch wollten wir GestalttherapeutInnen Gelegenheit geben, aus ihrer Praxis zu berichten. Wir wollen damit die theoretische Diskussion wie auch den Austausch über Praxiserfahrungen in der Arbeit mit traumatisierten Menschen anregen und beleben… Alle AutorInnen dieses Bandes arbeiten in unterschiedlicher und beeindruckender Weise eine Verankerung mit der Theorie und den Konzepten der Gestalttherapie heraus und zeigen, wie gut diese sich eignet, um mit traumatisierten Menschen zu arbeiten. Sie fördern damit die gestalttherapeutische Theoriebildung.“ (S. 8) Mit diesen Worten ist zum einen die Struktur dieses Buches zutreffend beschrieben: Den Hauptanteil bilden ausführliche Praxisberichte aus der Arbeit mit traumatisierten Menschen, die in der Regel theoretisch reflektiert und aufgearbeitet werden; hinzu kommen einleitend ein ausführlicher kompendiumartiger Literaturüberblick von Wolfgang Wirth, dann ein persönliches Interview mit Willi Butollo, der seit langem gestalttherapeutische Ansätze und Traumatherapie miteinander verbindet und abschließend eine kurze Zusammenstellung „genderspezifischer Bewältigungsstrategien“ (S. 239) von traumatischen Gewalterfahrungen aus gestalttherapeutischer Sicht von Beatrix Wimmer. Zunächst ist es mir wichtig, ein paar anerkennende Worte zu den Praxisberichten zu sagen: Sie beschreiben jeder auf seine Weise einen intensiven therapeutischen Prozess. Den LeserInnen wird sowohl das unendlich große Leid vor Augen geführt, das die KlientInnen teilweise erfahren mussten, als auch die wohltuende heilsame Kraft, die in der persönlichen therapeutischen Begegnung liegen kann. Um nur die ausführlichsten Prozessbeschreibungen anzusprechen: Ob Anja Jossen den therapeutischen Prozess mit einer Überlebenden des Kosovokrieges oder Collette Jansen Estermann ihren Weg mit einem durch sexuelle Gewalt traumatisierten Mann aus Bolivien oder Rotraud Kerner ihre Arbeit mit einer deutschen Frau beschreibt, die ebenfalls sexuelle Gewalt erleben musste, es sind jeweils sehr beeindruckende und überzeugende therapeutische Prozesse, die dort anschaulich und doch diskret beschrieben werden; viele berührende und Mut machende Beispiele dafür, wie das erlebte Trauma als „Schrecken ohne Sprache“ (S. 25) im Vertrauen darauf, dass die „Klienten selbst in sich alle Heilungspotentiale“ (S. 165) tragen, bewältigt und integriert werden kann. Meines Erachtens fehlt in dieser Zusammenstellung der HerausgeberInnen allerdings ein Beitrag, in dem aus gestalttherapeutischer Sicht die Arbeit mit Kriegstraumatisierten des Zweiten Weltkriegs und/oder ihren Nachkommen beschrieben wird und das, obwohl Willi Butollo in seinem Interview deutlich auf die offensichtliche „Nichtverarbeitung der fatalen Folgen des Zweiten Weltkrieges“ (S. 111) verweist.
Was die theoretischen Anteile der jeweiligen Artikel betrifft, so haben sie leider nicht alle eine solche Ausstrahlungskraft, wie sie von den Praxisberichten ausgeht. Bereits der erste Artikel, der in mühevoller Kleinarbeit alle möglichen gestalttherapeutischen Veröffentlichungen zum Thema Traumatherapie zusammenstellt, tut dies in einer wenig einladenden, eher unverbunden aneinandergereihten Art und Weise. So werden – zumeist in Anlehnung an entsprechende Veröffentlichungen von Bernd Bocian - z. B. traumatische Prägungen von Fritz Perls beschrieben. In der interessierten LeserIn taucht möglicherweise die Frage auf, welche Auswirkungen solche Erfahrungen auf die von ihm wesentlich geprägte Gestalttherapie wohl gehabt haben. Statt aber dieser Frage nachzugehen, folgt ein ausführliches Kapitel über PTSD-Diagnostik und auch in dem dann folgenden Kapitel über traumatherapeutische Elemente im gestalttherapeutischen Grundlagenwerk von Perls, Hefferline und Goodman fehlt jeder Bezug auf das zuvor Ausgeführte: Lediglich ein kurzer Hinweis darauf, dass die Gestalttherapie „in einer zutiefst vom Trauma zweier Weltkriege“ (S. 29) geprägten Epoche entstanden sei, weist noch einmal kurz in diese Richtung. - Da ist es dann ausgesprochen wohltuend, wie Anja Jossen in ihrem theoretischen Teil den zuvor von ihr beschriebenen traumatherapeutischen Prozess an Hand der ihr wichtigen gestalttherapeutischen Maximen beschreibt und der LeserIn damit noch einmal zusätzliche, auch selbstkritische (S. 85) Perspektiven eröffnet. Ebenfalls anregend ist Collette Jansen Estermanns Einführung des Galtungschen Begriffs der „Strukturellen Gewalt“ in die Traumadiskussion und ihre in diesen Zusammenhang gehörenden Thesen über den „Zusammenhang zwischen struktureller Gewalt und PTBS“. Demgegenüber wirkt der Theorieteil des Artikels von Rotraud Kerner eher überladen: Nicht genug damit, dass Sie in ihren Praxisprozess immer wieder Reflexionsgedanken einstreut und danach noch einmal ein ausführliches Kapitel „Reflexion des Prozesses“ anfügt. Nein, den längsten Teil ihres Artikels bildet dann noch der folgende Abschnitt „Theorie“, in dem sie die von Dreitzel so genannten „vier Säulen der Gestalttherapie“ in aller Ausführlichkeit beschreibt, auf ihre traumatherapeutische Arbeit bezieht und teilweise auch kritisch beleuchtet. Hierbei schüttet sie bei dem Umgang mit dem gestalttherapeutischen Prinzip des „Hier und Jetzt“ meines Erachtens das Kind mit dem Bade aus. Statt dieses Prinzip einfach als das zu belassen, was es ist, nämlich eine Ermutigung für TherapeutInnen, beim jeweils gegenwärtigen Kontakt zur KlientIn anzusetzen, überstrapaziert sie dieses Prinzip, indem sie es in vier Aspekte, die sie „Hierjetzt“, „HIERJETZT“, „Hier! Jetzt“ und „Heutzutage“ nennt, ausdifferenziert, so als handele es sich nicht um ein richtungsweisendes Prinzip, sondern um eine theoretische Begriffsdefinition. Demgegenüber sind Thomas Schöns auf die Praxis seiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bezogene und auf gestalttherapeutischen Konstrukten basierende Ausführungen über „Vermeidungsstrategien an der Kontaktgrenze“ durchaus anregend. Es mutet allerdings schon seltsam an, dass er auf den eigentlich veralteten Begriff der „Vermeidungsmechanismen“ zurückgreift und nicht auf das auf Wheeler zurückgehende weiterführende Konzept der „Kontaktfunktionen“, das diese Strategien als kreative Lösung des Organismus versteht. Abschließend will ich noch zweierlei zu den in diesen Artikeln vertretenen theoretischen Ansätzen anmerken: Die erste betrifft den Umgang mit dem Begriff der PTBS. Hier überwiegt in den Artikels eine Sichtweise, die diesen Begriff verwendet, als handele es sich um eine Realität und nicht um ein Modell von Realität, z.B. : „Jeder Krieg führt zwangsläufig zu PTBS“ (S. 95). Darüber hinaus gibt es allerdings auch eine kritische Anmerkung von Collette Jansen Estermann zu diesem Modell: Angelehnt an Fischer und Riedesser bemängelt sie, dass bei dem Begriff der „Posttraumatischen Belastungsstörung“ der Eindruck erweckt werde, dass „das Leiden bereits vorbei wäre“ (S. 136) und dass von Störung zu reden zu einer „pathologischen Stigmatisierung“ (ebd.) führe. Beide Argumente erscheinen mir aus gestalttherapeutischer Perspektive ausgesprochen wichtig zu sein. Was mir allerdings unverständlich bleibt, ist, dass die Autorin – ebenfalls in Anlehnung an Fischer und Riedesser – die Auffassung vertritt, dass es trotz dieser wesentlichen inhaltlichen Widersprüche „vorteilhaft“ sei, „dass dennoch die gleiche Kurzformel ‚PTBS‘ verwendet werden kann“ (ebd.) Vorteilhaft für wen? frage ich mich. Vielleicht tatsächlich für die betroffenen Klienten, weil sie dann eventuell leichter mit der Krankenkasse abrechnen können. Sicherlich aber nicht für die notwendige traumatherapeutische Theoriebildung , in der dann wesentliche (auch gestalttherapeutische) kritische Aspekte lediglich im Untergrund agieren und damit leicht bagatellisiert werden können. Ein anderer Aspekt, der mir vom gestalttherapeutischen Prozessdenken her wichtig erscheint, ist der Umgang mit den etablierten vier Schritten der Traumatherapie, der in fast allen Artikeln vorausgesetzt wird: „Jede Traumatherapie, gleich aus welcher methodischen Richtung kommend, erkennt heute die Notwendigkeit der Arbeit in vier Schritten oder Phasen an (Sicherheit, Stabilisierung, Konfrontation, Integration)“. (S. 185) Lediglich Rotraud Kerner vertritt da explizit eine Gegenposition, indem sie die „Überzeugung“ vertritt, „dass konsequente Stabilisierung… bei früh und chronisch Traumatisierten die Therapie der Wahl ist und alleine völlig ausreicht“. (182) Dies entspricht auch meiner Erfahrung und verdeutlicht die gestalttherapeutische Maxime, dass es wichtiger ist, den jeweiligen Menschen und seinen Prozess im Blick zu haben, als sich in der therapeutischen Arbeit an vorgegebenen allgemeinen Normen gefangen nehmen zu lassen. Insgesamt ist es ein anregendes Buch, das vor allem durch seine Praxisberichte beeindruckt. Ob es dem Buch auch gelingt, „ die gestalttherapeutische Theoriebildung“ (S. 8) zu fördern, wie es die HerausgeberInnen in der Einleitung beschreiben, wird wesentlich vom Leseverhalten der jeweiligen LeserInnen abhängen. Meine Empfehlung ist in diesem Zusammenhang, das Buch nicht am Stück zu lesen, da können die aneinander gereihten theoretischen Auslassungen der einzelnen AutorInnen eher redundant und ermüdend wirken, sondern sich beim Lesen von seinem jeweiligen Interesse leiten zu lassen und sich die dem entsprechenden Perlen herauszupicken.
Ulrich Lessin
|